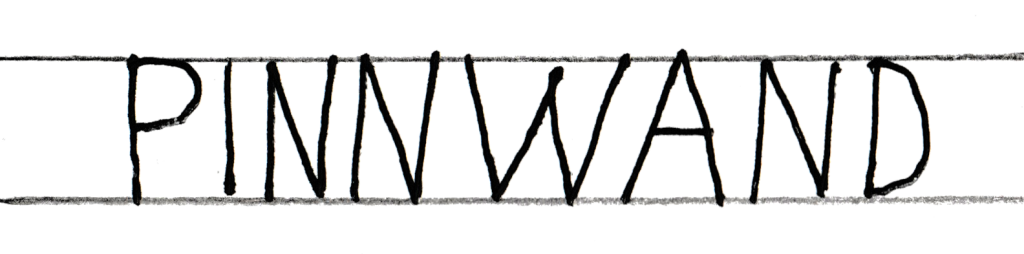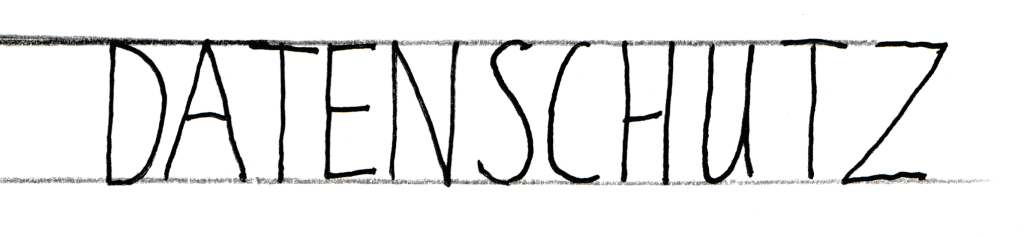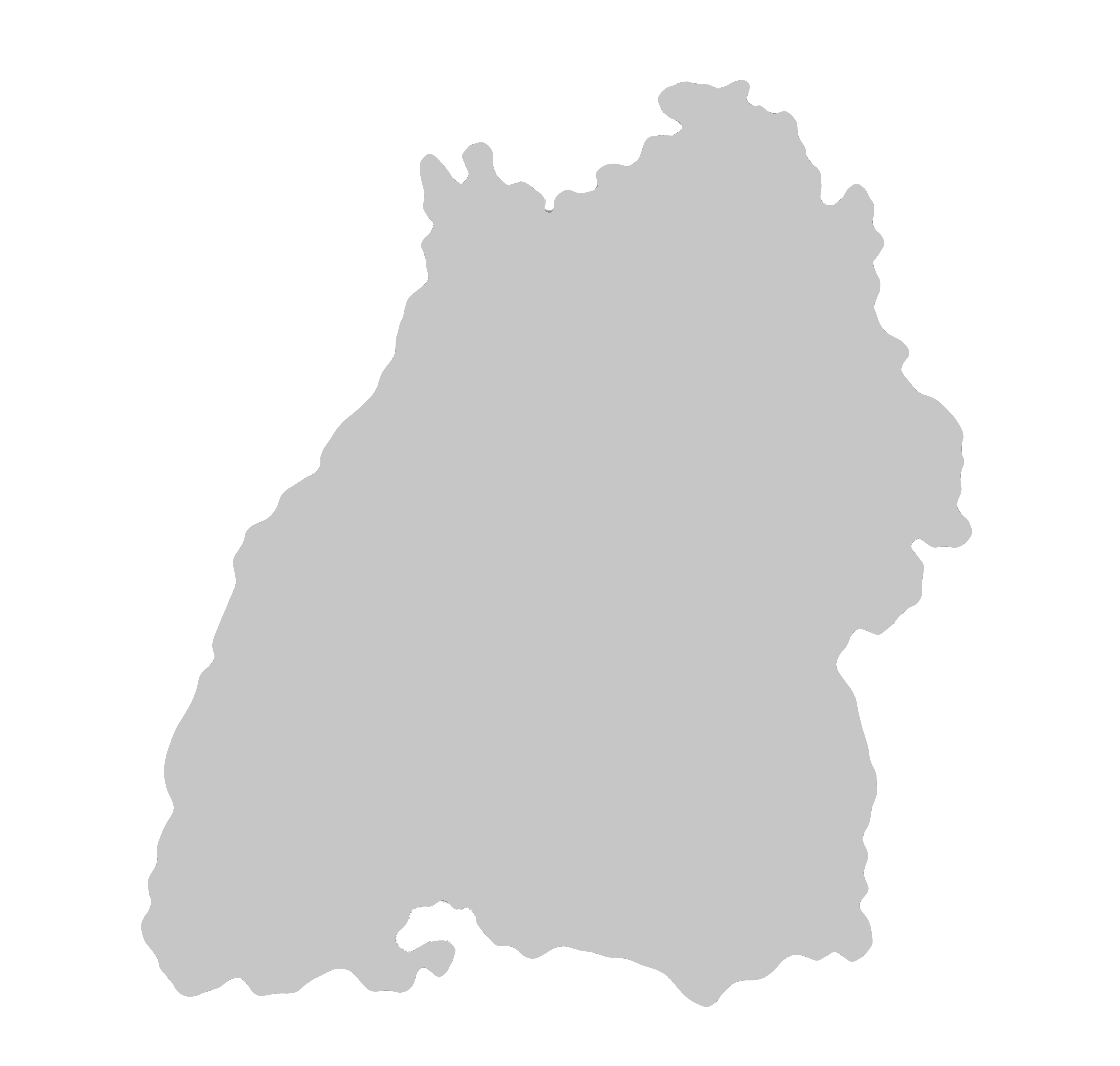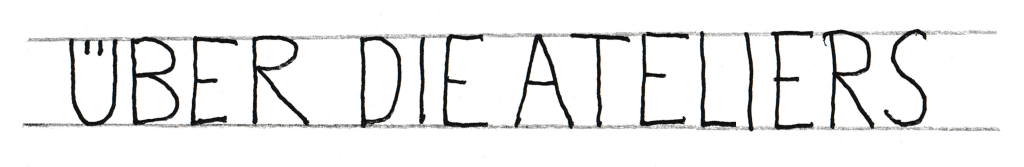
Offene Ateliers in Baden-Württemberg – Eine Erkundung
Wo sind Menschen mit Psychiatrieerfahrung und/oder kognitiver Beeinträchtigung in Baden-Württemberg kreativ tätig? Für die auf dieser Website präsentierte Übersicht recherchierten wir nach betreuten künstlerischen Werkstattgemeinschaften.
Die ausgewählten Ateliers unterscheiden sich in zahlreichen Aspekten. Um mehr über ihre Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu erfahren, haben wir einen Fragebogen entwickelt und die Antworten von 27 Atelierleiter*innen ausgewertet.
Anzahl und Vielfalt der gefundenen Offenen Ateliers haben uns überrascht. Die meisten waren uns, trotz langer Erfahrung in diesem Bereich, nicht bekannt. Fehlende Sichtbarkeit, Öffentlichkeit und Vernetzung der Einrichtungen dürften das erklären. Sicherlich ist es eine Herausforderung, heutzutage in der Kunstszene sichtbar zu werden. Eine Reihe von Offenen Ateliers konzentriert sich zudem auf ihre internen Vorgänge. Doch wünschen sich alle eine stärkere Sichtbarkeit und Vernetzung. Dafür setzt sich unser Projekt ein.
Gründung und Entwicklung von Offenen Ateliers in BW
Am Anfang der Geschichte der Offenen Ateliers in Baden-Württemberg steht die Pioniertat der Künstlerin Anne Dore Spellenberg, die Gründung der Kreativen Werkstatt der Remstal Werkstätten in Stetten 1966, die bis heute existiert. Auch die anderen Offenen Ateliers im Bundesland gehen vorrangig auf die Initiative engagierter Einzelpersonen zurück, seien es Künstler*innen, Kunstpädagog*innen, Kunsttherapeut*innen oder einfach Kunstinteressierte. Dabei fällt auf, dass die meisten dieser Werkstätten zwischen 2010 und 2020 gegründet wurden. Nur vier sind in den 1980er Jahren entstanden.
Oftmals gab es im Laufe der Zeit einen Wandel der Ziele, etwa wegen tatsächlich realisierter Utopien, weil das betreffende Atelier den Status als Gegen-Ort verloren hatte oder weil es eine reine Auffangvorrichtung wurde. Zum Beispiel wandelte sich ein zunächst in den Zugangsregeln minimal reguliertes Atelier zu einem begrenzt zugänglichen therapeutischen Kreativraum für Patient*innen. Andernorts wandte man sich umgekehrt von der kunsttherapeutischen Ausrichtung ab hin zur „rein“ künstlerischen Orientierung. Selbstorganisierte Gruppen scheinen ihre Orte eher konstant als „Freiräume für Kreativität“ zu bewahren, ähnlich konstant verstehen Kunstwerkstätten Kunst und Kunsthandwerk als Arbeit.
Die Gruppen in den Offenen Ateliers entstanden auf vielfältige Weise. In einigen Fällen wurden bereits bestehende Gruppen übernommen. Teilnehmende wurden durch engagierte Eltern, allgemeine und individuelle Einladungen, auch an die Tätigen im Werkstättenbereich, Mund-zu-Mund-Propaganda, Zeitungsannoncen sowie durch Flyer gewonnen. Mancherorts wurde die Teilnahme durch einen niedrigschwelligen Zugang erleichtert. Bei einem Atelier wirkte das gemeinsame Interesse an der Aufarbeitung des NS-Massenmords als verbindendes Element und brachte neue Ideen hervor. Bei den kunsthandwerklichen Kreativwerkstätten spielten die Fragen: Wer kann was? Wer möchte es lernen? eine gruppenbildende Rolle. Mehrheitlich gilt heute: Alle Interessierten sind herzlich willkommen.
Die meisten Kunstwerkstätten erfahren eine Fülle an Unterstützung und positiver Resonanz seitens der Träger, zumal gerade größere Träger verstehen, dass die Förderung künstlerischer Kreativität in besonderer Weise zu ihrem positiven Image in der Öffentlichkeit beiträgt. Mitunter haben gerade leitende Mitarbeiter*innen der tragenden Institutionen die Entstehung angeregt. Die Träger gewähren guten Rückhalt. Doch trotz Wertschätzung schränken vereinzelt fehlende oder reduzierte Räumlichkeiten und Personalmangel den Betrieb der Ateliers massiv ein. Durch Konkurrenz zu anderen Angeboten oder wirtschaftliche Rentabilitätsüberlegungen wird die Daseinsberechtigung einiger Ateliers sogar infrage gestellt. Ob die Unterstützung eigennützig oder als großzügige soziale Geste geleistet wird, macht letztlich keinen Unterschied. Die faktische Unterstützung ist entscheidend. Offenheit und Affinität der Träger zur Kunst sind auf jeden Fall hilfreich.
Der Organismus der Ateliers
Die Träger der Offenen Ateliers sind vielfältig. Hinter den meisten stehen entweder die evangelische (Diakonie) oder katholische Kirche (Caritas), Stiftungen bürgerlichen Rechts, gemeinnützige Stiftungen oder größere gemeinnützige Vereine, oder sie sind selbst Anstalten öffentlichen Rechts. Nur wenige Offene Ateliers werden von eigenen kleineren Vereinen getragen. Die Förderung der teilnehmenden Persönlichkeiten steht für alle Träger im Vordergrund, was durch die Finanzierung der Arbeitsplätze mit Hilfe von Mitteln zur beruflichen Wiedereingliederung oder des persönlichen Budgets unterstrichen wird. Selbst bei größeren Trägern gibt es zudem immer wieder Unterstützung durch Geld- und Sachspenden.
Die Leitung der Offenen Ateliers wird meist von ein bis zwei Personen übernommen, nur selten werden mehr als fünf Leiter*innen (vielfach auch Kunstassistent*innen genannt) eingesetzt. Dabei gibt ehrenamtliche Tätigkeit genauso wie Tätigkeit auf Honorar- oder Werkvertragsbasis oder Festanstellung. Teils werden nur die eigentlichen Mal- und Werkstunden bezahlt, teils auch die Zeit für zusätzlich anfallende Aufgaben. Zumeist arbeiten weitere Ehrenamtliche und/oder Student*innen und Schüler*innen als Praktikant*innen in den Ateliers mit. Oft haben die leitenden Personen ein kunsttherapeutische oder kunstpädagogische Ausbildung, nicht wenige begreifen sich zugleich selbst als Künstler*innen. Nur selten hat die Leitung keinerlei professionelle Verbindung zum Künstlerischen.
Die Zahl der Teilnehmenden überschreitet meist 10 oder 12 nicht. Nur selten ist die Zahl über die Jahre auf 45 oder 50 angewachsen. Zumeist werden zudem Gruppen gebildet, die sich zu verschiedenen Zeiten treffen; manchmal gibt es sogar Einzelbetreuung. Die Häufigkeit der Aktivität liegt zwischen vierzehntägigen Treffen für zwei bis drei Stunden und täglichen Atelierzeiten, wenn auch teils mit wechselnden Angeboten. Der feste Raum für die Ateliers wird öfters ebenfalls von anderen Gruppen genutzt. Die Ateliers mit festen Arbeitsplätzen, an denen die Teilnehmenden die angefangenen Werke bis zur nächsten Sitzung liegen lassen können, sind mit ca. 30% in der Minderzahl.
Der dominierenden Trägerschaft durch größere Einrichtungen entspricht, dass die meisten der Offenen Ateliers exklusiv für Menschen mit Psychiatrieerfahrung oder kognitiver Beeinträchtigung eingerichtet sind. Nur wenige Initiativen sind bereit, das Atelier auch für Menschen ohne Behinderung zu öffnen. Sie begreifen es als Ort der Begegnung, der Zugang zu Kunst und Kultur ermöglicht und in die Gesellschaft hineinwirkt.
Begabungskriterien spielen bei der Auswahl der Teilnehmer*innen der Offener Ateliers nur zu etwa 40% eine Rolle, vielmehr bestimmt zumeist allein die Neigung zum Bildnerischen oder zu kunsthandwerklichem Arbeiten die Aufnahme. Dennoch gibt es bei manchen Ateliers Schnupper- oder Hospitationsphasen von bis zu drei Monaten, bevor jemand als feste/r Teilnehmer*in akzeptiert wird. Andererseits werden in einer Reihe von Ateliers auch Menschen geduldet, die sich nicht an den künstlerischen Aktivitäten beteiligen, sondern sich nur gerne dort aufhalten und mit den anderen reden. Sie bestimmen nicht unwesentlich die Atmosphäre in den betreffenden Ateliers.
Entsprechend der vorherrschenden Trägerschaft großer Einrichtungen werden Räumlichkeiten und Materialien der Offenen Ateliers meistens kostenfrei für die Teilnehmer*innen zur Verfügung gestellt; allerdings leiten einige Träger daraus ein zumindest gewisses Recht am Eigentum der entstehenden künstlerischen Werke ab. In anderen Ateliers, vor allem solchen, die von kleineren Vereinen oder von städtischen Einrichtungen (VHS) getragen werden, müssen die Teilnehmer*innen einen geringen Unkostenbeitrag (5 bis 10 Euro pro Monat oder Veranstaltungstermin) zahlen.
Das Zusammenkommen, das Zeichnen, Malen, Töpfern, sich mit Kunst Beschäftigen, Sich-Angenommen-Fühlen und auf Augenhöhe-Arbeiten, wird häufig als bereichernd beschrieben. Überhaupt wurde die Möglichkeit, frei arbeiten zu können, immer wieder betont. Nicht wenigen Ateliers geht es an erster Stelle nicht „um das Herstellen von Kunst“. Vielmehr wird das kreative Arbeiten unter Anleitung eines/r Künstler*in ohne Druck als etwas Besonderes beschrieben, wahrscheinlich in Abgrenzung zur Arbeit in den Werkstätten. Einzelne Ateliers betonen, dass es sich bei der Atelier-Arbeit nicht um Kunsttherapie handelt. Andere Ateliers wiederum räumen ein, dass sich bei der Arbeit im Atelier kunsttherapeutische und frei künstlerische Ansätze durchdringen. Zum Selbstverständnis einiger Ateliers gehört auch, das Potential Einzelner zu entwickeln und am Handwerk des Zeichnens und Malens sowie an der Professionalität im Umgang mit bildnerischen Techniken zu arbeiten.
Nach außen wird eine positive Wahrnehmung des Phänomens Psychiatrieerfahrung oder Behinderung durch ästhetische Erfahrung angestrebt. Ziel ist es, die eigenständigen Potentiale und Ressourcen der Atelierkünstler*innen herauszustellen.
Die Art der künstlerischen Arbeit in den Ateliers wird zumeist den Teilnehmenden selbst überlassen, wobei einige Kunstassistent*innen sich explizit am Konzept des freien oder Ausdrucksmalens von Arno Stern (*1924) orientieren. Trotzdem gibt es in vielen Ateliers gelegentlich auch Themenvorgaben, zumal vor bestimmten Festtagen, oder es werden gemeinsame Werke erarbeitet. Ausschließliches Arbeiten nach (Design-)Vorgaben ist die Ausnahme. Doch findet sich in den meisten Ateliers „zur Inspiration“ ein Vorrat an Zeitschriften und (Kunst-)Büchern, und Teilnehmer*innen nutzen die Möglichkeit, im Internet nach Vorbildern oder Vorlagen zu recherchieren. Viele Ateliers bieten überdies gelegentlich Workshops an, teils geleitet von eingeladenen Honorarkräften, in denen neue Techniken vermittelt werden, und unternehmen mit den Teilnehmer*innen Ausflüge zu Kunstausstellungen oder Exkursionen zu Kulturstätten.
Ausstellungen und Archive
Das Organisieren von Ausstellungen in Galerien und Kunstvereinen sowie die Zusammenarbeit mit Kunstakademien und Kooperationen verschiedenster Art ist einzelnen Ateliers sehr wichtig. Öffentlichkeit herzustellen wird als häufiges Ziel im Selbstverständnis der Ateliers genannt. („Kunst als Türöffner zur Welt“, das Atelier „als lebendiger kreativer Ort“). Doch wenige Ateliers sind in der Lage, regelmäßig Ausstellungen an unterschiedlichen Orten (eigene Räumlichkeiten, Kunstvereine oder Galerien) durchzuführen. Oft lässt die personelle Situation eine kontinuierliche Ausstellungstätigkeit nicht zu. Der Gewinn von Verkäufen in Ausstellungen wird oft anteilig mit den Künstler*innen verrechnet. Aber auch die Finanzierung von Papier, Farbe oder Material wird dadurch unterstützt.
Sehr wenige Offene Ateliers verfügen über Lagerräume für Bilder, Rahmen, Malmaterial oder gar ein Archiv. Ateliers, in denen 6-10 Künstler*innen über Jahre hinweg arbeiten, brauchen einigen Platz, um die entstandenen Arbeiten lagern zu können. Zudem fehlt den Atelierleitungen meistens die Zeit, die Arbeiten systematisch zu lagern oder zu archivieren. So bleibt es nicht aus, dass Offene Ateliers Werke wegwerfen.
Einzelne Ateliers fotografieren die entstandenen Arbeiten oder scannen sie ein, wieder andere sammeln alles, was über das Atelier publiziert wird (Plakate, Flyer etc.). Einige Atelierkünstler*innen nehmen auch ihre Werke mit nach Hause. Häufig aber leben und wohnen sie in Wohnungen bzw. Wohngemeinschaften, die nur sehr begrenzt Platz für Bilder und anderes bieten.
Kooperationen, Internetpräsenz und Vernetzung
Etwa die Hälfte der Offenen Ateliers hat schon mit ähnlich arbeitenden Ateliers in der näheren Umgebung kooperiert. Allerdings sind durch die Corona-Pandemie viele dieser Kontakte eingeschlafen, und die Wiederaufnahme erweist sich als schwerfällig. Vereinzelt gibt es deutschlandweite Kontakte, allerdings nur wenige Kooperationen.
Vor allem an den Ländergrenzen liegende Ateliers haben internationale bzw. länderübergreifende Kooperationen mit anderen Ateliers. Für den Bereich des Dreiländerecks gibt es bereits die Vernetzungsplattform KulturGrenzenlos (https://kulturgrenzenlos.eu/ ). Kaum ein Atelier ist Teil der europaweiten Vernetzung über die European Outsider Art Association (EOA, https://outsiderartassociation.eu). Doch haben fast Ateliers den Wunsch nach mehr Kontakt zu anderen Offenen Ateliers, vor allem auf regionaler Ebene.
Die Liste der Kooperationen mit künstlerischen, kulturellen oder sozialen Institutionen ist hingegen sehr lang, auch wenn knapp ein Drittel der befragten Ateliers außerhalb des Trägers nicht mit anderen Institutionen zusammenarbeiten. Vor allem zu Ausstellungszwecken gibt es Kooperationen, ebenso im Zusammenhang mit Workshops oder Projekten. Angegeben werden hier: Bezirkssparkassen, Bibliotheken/städtische Büchereien, Cafés, Diakonische Einrichtungen oder andere soziale Träger, Festivals, Galerien, Hospize, Kitas, Kulturämter, Kulturzentren, Künstler*innen, Kunstvereine, Landratsämter, Museen, Pädagogische Hochschulen, Schulen, die VHS, Banken.
Wenige Offene Ateliers haben eine eigene Website. Oftmals sind die Atelierangebote nicht im Internet zu finden. Am häufigsten sind die Angebote auf den Websites der Träger verlinkt, teilweise allerdings nur in Form von Berichterstattung über größere Ereignisse/Projekte oder Veranstaltungen. Da die Pflege der Website meist als schwierig in der Zusammenarbeit mit größeren Trägern beschrieben wird, gibt es zunehmend Social Media Auftritte bei Instagram, vereinzelt sogar Dokumentationen über Projekte auf YouTube.
Am häufigsten wünschen sich die Ateliers von unserer Vernetzungsplattform Sichtbarkeit, Austausch und die Möglichkeit zur Kooperation. Die Beteiligten sehen unser Projekt als weitere Möglichkeit zur Öffentlichkeitsarbeit und zur Präsentation der Ateliers für ein breiteres Publikum.
Außerdem gibt es den Wunsch, Künstler*innen der Ateliers miteinander in Kontakt treten zu lassen, so dass ein künstlerischer Austausch stattfindet. Eine Idee ist, Künstler*Innen aus den Offenen Ateliers als Workshop-Leiter*Innen/Dozierende in andere Offene Ateliers einzuladen, um neue Arbeitsweisen kennenzulernen.
Kunstassistent*innen und Atelierleitungen haben ferner oftmals das Bedürfnis, sich über ihre Erfahrungen, inhaltliche Fragen, konkrete Ideen, Impulse, Inspirationen und Arbeitsweisen auszutauschen. Spezifische Wünsche richten sich auf organisatorische Fragen, wie Finanzierungsmöglichkeiten, rechtliche Aspekte, Atelierorganisation, Teilnahme an Wettbewerben und Erfahrungen mit Ausstellungen. Diskussionen über gesellschaftspolitischen Themen im Dialog mit den Betroffenen werden erwogen.
Gesucht werden zudem konkrete Strategien für den Zugang zum Kunstmarkt und die Vermarktung von Werken. Und schließlich wünscht man von der Vernetzungsplattform die Veröffentlichung von Terminen, um über Veranstaltungen, Ausstellungen, Projekte und Wettbewerbe informiert zu werden.